Report: Ihre Firma hat eine neue Struktur. Ist SBT neu übersichtlicher?
Herbert Wegleitner: Zum ersten: Landis & Staefa ist vor dem Sommer legal in die Siemens Building Technologies GesmbH & Co integriert worden. Die Managementverantwortung ist ebenfalls voll integriert. Wir haben nun fünf Divisionen: Produkte und Systeme - Security Systems und Fire Safety, Building Automation HVAC-Products, Dienstleistungen - Lifecycle Building Systems, Facility Management & Services sowie Anlagen - Electrical Systems und Bacon, ein Joint Venture mit der Ortner Gruppe.
Ist die Marke Landis & Staefa damit Vergangenheit?
Landis & Staefa bleibt weiter der Brand auf Produkt- und Systemebene. über allem steht die Marke Siemens. Nachdem Geschäftsinhalte bedeutend stabiler sind als Organisationsstrukturen wird das auch länger so bleiben.
Hat österreich nun nachgegeben und sich der Konzernstruktur gefügt?
Nein, österreich hat lange gekämpft die Struktur, die sie, auf Grund ihrer besonderen Marktstellung, erreichen wollte zu erlangen. Auf Konzernebene läuft der Integrationsprozess zwei. SBT wird in Zukunft sehr enger mit den Siemens Landesgesellschaften arbeiten. Wie viele
Mitarbeiter arbeiten nun für SBT-österreich und welchen Jahresumsatz erzielen Sie?
Direkt bei SBT, ohne Joint-Venture Partner Bacon arbeiten rund 1.135 Mitarbeiter für uns. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2002, das bei uns mit 30. 9. 2002 endet beträgt im Forecast alles in allem knapp 250 Millionen Euro. Aus dem Bereich Facility Management stammen 44 Millionen Euro, 58 Millionen kommen aus der klassischen Elektroinstallation, 26 Millionen aus dem Life-Cycle-Building-Geschäft, 69 Millionen aus Fire Safety und Security Systems sowie 52 Millionen Euro aus der Landis & Staefa.
Wem berichten Sie über Erfolg und Misserfolg?
Ich sitze in der Mitte zwischen der Landesgesellschaft österreich und dem geschäftsführenden Bereich SBT Zürich. Mein Gehalt bestimmt der Vorstand der Siemens AG österreich und ich arbeite im österreichischen Markt.
Wie viele der Mitarbeiter arbeiten im Bereich Facility Management und was tun die konkret?
Das sind derzeit 235, vor drei Jahren waren es noch 145. Unser Business ist Betriebsführung und Instandhaltung von Gebäuden. Die Facility-Management-Truppe hat von ihrem Denkansatz den Lebenszyklus eines Gebäudes stärker im Kopf wie ein klassischer Errichter. Wenn jemand 20 Jahre Gebäude errichtet, dann sind Denkmuster im Kopf, die nicht wirklich lebenszyklusorientiert sind. Der Facility Manager ist dazu verdammt langfristig am Kunden zu arbeiten..
Im Bereich Fire Safety und Security Systems zeichnet sich auf Konzernebene eine Trennung ab. Gilt das auch für österreich?
Im Stammhaus ist die Trennung vollzogen, in den Regionen wird das stärker getrennt werden da im Security-Bereich eine Offensive in den Strategiebüchern steht. In der Brandmeldetechnik haben wir einen Marktanteil zwischen 50 und 60 Prozent in dem von uns bearbeiteten Markt. Das ist der gesamte Hochbau, nicht aber der Wohnbau und Einfamilienhäuser. Dem entsprechend sieht auch die Vertriebsorganisation aus. Unsere Verkäufer kennen ihren Markt seit 20 Jahren. Wir wollen jetzt die Aktivitäten im security Bereich stärker bündeln. Mehr Push ist nur durch eine fukusierte Vertriebsstruktur zu erreichen. Wir trennen die Bereiche aber nicht ganz, die Servicepools in den Regionen bleiben gemeinsam, weil ja die erreichte Produktivität aufrechterhalten bzw. weiterentwickelt werden muss.
Hat man im Bereich Security Systems in der Vergangenheit etwas versäumt?
Siemens hat diesen Bereich lange Zeit nicht mit dem entsprechenden Fokus betreut. Erst mit dem Hinzukommen von Cerberus kam eine gemeinsame stärkere Positionierung und eine notwendige Produkt- und Nach der Integration vor rund zwei Jahren wurde die Verstärkung im Produktgeschäft und im Segment Security Systems beschlossen, weil in diesen Bereichen auch international die Marktsteigerungsraten am größten sind.
SBT ist damit nicht allein, Johnson Control etwa baut seine Aktivitäten in diesem Bereich auch aus. Wer ist eigentlich Marktführer?
Johnson Control ist einer der aggressivsten Mitbewerber. Die Frage der Marktführerschaft ist nicht zu beantworten. Security Systems ist ein extrem fragmentierter Markt. Da gibt es Zutrittslösungen auf verschieden Stufen, Videoüberwachung, Intrusionsschutz, etc. - alles im Grunde unabhängige Segmente mit spezialisierten Marktteilnehmern.
Wie sieht die Marktverteilung in österreich in etwa aus?
Unseren Marktaufzeichnungen zufolge Zutrittsbereich ist PKE, also Philips Nummer 1, Interflex Nummer 2, Gantner Dritter und SBT-SES Vierter. Im Video-Bereich ist erneut Philips Nummer eins, SBT-SES Nummer 2, ARS 3. Im Feuerbereich ist es klar, da sind wir lange am Markt und Nummer eins, vor Schrack Seconet und Acer.
Wie sieht die Zukunft der Gebäudesicherheit aus?
Im Bereich Zutrittskontrolle ist vieles möglich. Mit einem Chipkartensystem können nicht nur der Zugang, sondern auch die Stunden der Mitarbeiter erfasst werden und diese bestimmten Aufträgen zugeordnet werden. Damit landen wir im Kernprozess des Kunden. Früher landete man bei Sicherheitsdiskussionen mit Kunden stets dort wo man fragte: was machen wir technisch, was machen wir über Personal und welche Organisation ist vorhanden. Heute leben wir aber in einer Zeit der offenen Systeme und der zunehmend integrierten Lösungen. Um zum Beispiel Zutrittsysteme mit der Kostenrechnung zu koppeln müssen die diversen Schnittstellen genutzt werden.
Sie waren Gründungsmitglied des Verbandes Total Facility Management, der in der Versenkung verschwunden ist.
Die Ursprungsidee des Total FM war als Add on zum Schwesternverband die lebenszyklusorientierte Betrachtung des Geäudes herauszustreichen. Im Lauf der Zeit trat die Diskussion zutage, was machen wir gemeinsam und was machen wir als Mitbewerber jeder für sich? Das ist nun zwischen den Mitgliederfirmen weit gehend geklärt und wir werden uns wieder mit gemeinsamen Lobbying bemerkbar machen.
Seit kurzem macht SBT für die Verwaltungsobjekte der Bank Austria das Facility Management. Ist das ein erster Schritt mit der Bank-Tochter Domus FM zu kooperieren?
Im Facility Management muss man immer mit jemandem kooperieren. Es gibt keine konkreten überlegungen mit der Domus. Und es gibt keine konkreten überlegungen Domus zu kaufen oder ähnliches. Die Bank Austria hat mit der Vollintegration der Creditanstalt im Moment sicher wesentlichere Prioritäten. Was es gibt ist eine gute Zusammenarbeit, der Auftrag ist gut angelaufen und wir haben natürlich das Interesse die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen..
Wie groß ist dieser Auftrag?
Es ist der größte Einzelauftrag den wir haben. Was ich aber anmerken möchte ist, das wir im FM Geschäft nicht den Weg des allumfassenden Outsourcing anstreben. In österreich und zum Teil Deutschland wurden diese großen Projekte wieder abgebrochen. Ich glaube, dass der Grund dafür darin liegt, dass beide Seiten innerhalb sehr kurzer Zeit bedeutende Entscheidungen, mit wesentlichen Risiken treffen mussten. Bei Industrieunternehmen ist der Betrieb eines Gebäudes ein lebenswichtiger Nebenprozess. Diesen Nebenprozess jemanden zu übergeben, den man nur über eine Ausschreibung und ein paar vorbereitende Gespräche kennt ist gefährlich. Umfassendes Facility Management bedarf auch menschlich einer gewissen Annäherung und gewachsenes Vertrauens. Ein weiterer Kernpunkt ist das zu übernehmende Personal: Der abgebende Partner hat oft Personal mit einem höheren sozialen Status wie der FM-Anbieter. Arbeitsrechtlich können Mitarbeiter nicht gezwungen werden von A nach B zu wandern. Ich denke es ist sinnvoller mit dem Kunden gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und Outsourcing step by step anzugehen.
Gibt es aktuelle Beispiele für gescheiterte Annäherungen?
Vom Mitbewerb weiß ich das nicht im Detail. Wir führten Gespräche mit Opel, das ist allerdings zwei ein halb Jahre her, sehr intensive Gespräche, die letztendlich gescheitert sind. Wir wissen bis heute nicht was letztlich der Grund war. Fest steht, dass es sehr häufig auch daran scheitert, dass der interne Betriebsführer ganz andere Zielsetzungen hat wie der externe.
Einige Zeit war in der Branche häufig die Rede von Performance Contracting. Ist das wieder vorbei?
Für mich ist Performance Contracting kein Geschäft, sondern ein Verkaufsart. Bei größeren Projekten ist Performance Contracing lediglich eine Form der CO-Finanzierung. Bei Teilsanierungen kann es sich durchaus voll amortisieren. Prinzipiell wäre klug, wenn Sanierungen gesamtheitlich betrachtet würden. Das ist jedoch nur möglich wenn ein Gebäudeeigner eine langfristige Bewirtschaftungsstrategie hat. Am Beispiel erklärt: Es gibt eine ganze Reihe von Verwaltungsgebäuden die von der Ausstattung sehr energieintensiv sind und hohe Betriebskosten verursachen. Dort lässt sich mit Gebäudeautomatisierungstechnik viel bewegen und rasche Amortisation erzielen. Auch die thermische Sanierung ist ein wichtiger Faktor. Wichtiger sind jedoch ganz andere Strömungen: Bund und Länder haben ihre Immobilien abgetreten oder sind dabei Nutzerfunktion und Eigentümerfunktion stärker zu trennen. Die Nutzer müssen aus Budgetgründen ihre Kosten senken und könnten in modernen Büros billiger wegkommen. Wenn das viele tun ist die Bundesimmobiliengesellschaft ihre Nutzer los. Dann müssen dort überlegungen angestellt werden was mit diesen Flächen passiert und welche Nutzungen geplant sind. Werden aus Verwaltungsbauten zum Beispiel Hotels und hochwertige Wohnungen, dann ergibt sich für die Bauwirtschaft ein gesamtheitlicher Sanierungsbedarf. Es wäre klug, die Zukunft der Immobilie zu definieren und erst dann die Sanierung zu starten. Zugegeben, etwas schwarz weiß dargestellt, aber der Trend ist erkennbar.
Was wurmt Sie in österreich?
Als Geschäftsführer hier wurmt mich, dass private Investitionen sehr stark zurückgenommen wurden und zugleich der öffentliche Budgetdruck anhält. Wir hoffen, dass wir heuer im Herbst die negative Stimmung überwinden in der die Leute fertige Projekte in der Schublade liegen lassen. Was mir ebenfalls ein Anliegen ist, ist die gesamtheitliche, integrale Sanierung auf Basis strategischer Bewirtschaftungskonzepte. Denn wenn Sanierungen konzeptionell angegangen werden ist auch für den Kunden mehr Potential zu heben, das gilt für den Privaten wie den öffentlichen.
 Der geförderte Wiener Wohnbau bekommt eine neue Säule. Den Grundkriterien Planung, Ökonomie und Ökologie wird die soziale Nachhaltigkeit zur Seite gestellt. Neuer Jury-Vorsitzender ist der Direktor des Architekturzentrums Wien Dietmar Steiner.
Der geförderte Wiener Wohnbau bekommt eine neue Säule. Den Grundkriterien Planung, Ökonomie und Ökologie wird die soziale Nachhaltigkeit zur Seite gestellt. Neuer Jury-Vorsitzender ist der Direktor des Architekturzentrums Wien Dietmar Steiner.
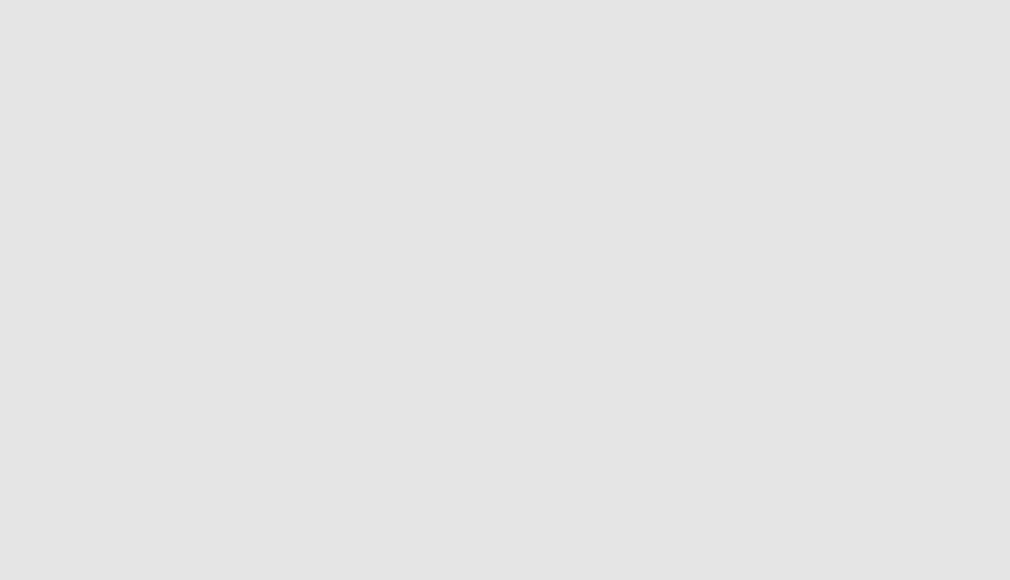

 Sanieren ist das Gebot der Stunde, dafür braucht es Förderungen. Es muss aber dem Eigentümer überlassen bleiben, ob die Förderung in Form von Sanierungskrediten oder Direktzuschüssen in Anspruch genommen wird. Ein Gastkommentar von Markus Riel, Internorm Fenster GmbH.
Sanieren ist das Gebot der Stunde, dafür braucht es Förderungen. Es muss aber dem Eigentümer überlassen bleiben, ob die Förderung in Form von Sanierungskrediten oder Direktzuschüssen in Anspruch genommen wird. Ein Gastkommentar von Markus Riel, Internorm Fenster GmbH.
 Anfang Dezember wurde Österreichs erstes Schwimmbad in Passivhausbauweise erröffnet.
Anfang Dezember wurde Österreichs erstes Schwimmbad in Passivhausbauweise erröffnet. Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 04/2012 (PDF und E-Paper). Die Stadt von Morgen. Die große Coverstory im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Kommunikation ist alles: Die urbane Zukunft baut auf die enge Vernetzung von Stadtplanung, Gebäuden, Energie, Mobilität und Industrie.
Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 04/2012 (PDF und E-Paper). Die Stadt von Morgen. Die große Coverstory im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Kommunikation ist alles: Die urbane Zukunft baut auf die enge Vernetzung von Stadtplanung, Gebäuden, Energie, Mobilität und Industrie. Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 05/2012 (PDF und E-Paper). Fit für die Zukunft. Die große Coverstory im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeit, BIM – die Schlagworte der Branche haben sich verändert. Wie die Ausbildungsstätten auf die neuen Herausforderungen reagieren.
Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 05/2012 (PDF und E-Paper). Fit für die Zukunft. Die große Coverstory im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeit, BIM – die Schlagworte der Branche haben sich verändert. Wie die Ausbildungsstätten auf die neuen Herausforderungen reagieren. Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 08/2012. EDV & Bau. Die große Umfrage im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Die beliebtesten CAD- und AVAProgramme. Wer aktuell die Nase vorne hat und wem die Zukunft gehört.
Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 08/2012. EDV & Bau. Die große Umfrage im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Die beliebtesten CAD- und AVAProgramme. Wer aktuell die Nase vorne hat und wem die Zukunft gehört. Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 10/2012. Fragen an die Politik. Die große Coverstroy im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Was die Bau- und Immobilienbranche tatsächlich interessiert.
Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 10/2012. Fragen an die Politik. Die große Coverstroy im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Was die Bau- und Immobilienbranche tatsächlich interessiert. Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 11/2012. Rückblick 2012, Ausblick 2013. Die große Coverstroy im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Die große Interviewreihe zum Jahreswechsel: Robert Jägersberger, Wolfgang Kradischnig, Friedrich Mozelt, Josef Unger, Erwin Fahrnberger und Helmut Oberndorfer im Gespräch.
Bau- und Immobilien Report, Ausgabe 11/2012. Rückblick 2012, Ausblick 2013. Die große Coverstroy im aktuellen Bau- und Immobilien Report. Die große Interviewreihe zum Jahreswechsel: Robert Jägersberger, Wolfgang Kradischnig, Friedrich Mozelt, Josef Unger, Erwin Fahrnberger und Helmut Oberndorfer im Gespräch.