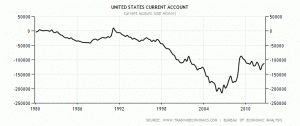Die vergangenen Wochen haben erneut gezeigt, dass die politische Führung in Europa die Euro-Krise nicht lösen kann. Das Einzige, was sicher ist: Die Politiker in Brüssel werden wie EZB-Draghi auch alles tun, um den Euro zu retten, buchstäblich alles.
Das Unvermögen der Brüsseler Politbürokratie zeigt sich an den beschlossenen inkonsistenten Maßnahmen im Falle Zypern: Spareinlagen werden zur Bankenrettung herangezogen, Anleihegläubiger aber geschont; Einlagen bei ausländischen Töchtern sind geschützt, Einlagen bei einheimischen nicht. Insbesondere letzteres wird dazu führen, dass lokale Unternehmen reihenweise pleite gehen mit entsprechenden Konsequenzen für die Entwicklung der Wirtschaft dort.
Auch wenn die Brüsseler Politik zunächst wieder von Plänen Abstand nahm, Spareinlagen unter 100.000 Euro anzuzapfen und damit gegen Garantien zu verstossen – sollte es jemals Vertrauen zwischen dem einfachen Bürger und den gewählten oder nicht-gewählten Führern gegeben haben, so ist das mit dem Desaster namens „Zypern-Rettung“ dahin.
Als Folge steigt die Wahrscheinlichkeit wieder zunehmender Kapitalflucht aus den Krisenländern. Das Vertrauen der Sparer zu zerstören, wiegt in Europa besonders schwer. Denn europäische Banken sind von Spareinlagen sehr viel stärker abhängig als z.B. in den USA, wo sich die Banken hauptsächlich über die Kapitalmärkte mit Mitteln versorgen.
De facto ist mit den Kapitalverkehrskontrollen in Zypern das gemeinsame Währungsgebiet bereits angeknackst. Ein Euro dort ist nicht mehr derselbe wie ein Euro woanders. Sollte die Krise nach Frankreich weiterziehen, was ziemlich sicher ist, wie soll in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone Kapitalflucht gestoppt werden?
Welche Auswirkungen wird das auf die Weltwirtschaft und das Währungsgefüge haben?
Der US-Dollar bleibt Reservewährung, er ist der Einäugige unter den Blinden von Pfund, Yen und Euro (der Schweizer Franken ist ein Sonderthema). Der Euro ist aktuell der herausragende Wackelkandidat, er kommt am wenigsten für diese Rolle in Frage. Ein wesentlicher Grund, warum der Dollar angesichts der QE-Politik der Fed und der hohen Verschuldung bisher nicht kollabiert ist, ist, dass die anderen Währungsgebiete in denselben Problemen stecken und dieselbe Politik betreiben.
Die Fed bleibt also weiterhin die Zentralbank der Welt und als solche ist es ihre Aufgabe, für die benötigte Liquidität zu sorgen. Dies geschieht indirekt durch das, von kurzen Episoden abgesehen, seit den frühen 1980er Jahren bestehende US-Leistungsbilanzdefizit.
An dem Chart ist gut zu sehen, dass das Defizit in Zeiten expansiver Finanzmärkte steigt, während es etwa im Umfeld von Rezessionen geringer wird, wenn der Dollar „heim geholt“ wird. Durch die zunehmende Entkopplung der umlaufenden Dollars von der Golddeckung tat sich in den 1960er Jahren das Problem der Rückkonvertierung (siehe u.a zum Triffin-Dilemma hier!). Das wurde durch das Ende des Bretton Woods Systems 1971 beseitigt.
An die Stelle von Gold treten heute US-Treasuries, die Besitzer dieser Währungsreserven haben Anspruch auf Rückkonvertierung in Dollar. Dieser Anspruch steht umso mehr auf dem Prüfstand, je länger das Leistungsbilanzdefizit besteht, oder, was auf dasselbe hinausläuft, je länger die hohe Verschuldung der USA besteht.
Die weltweite wirtschaftliche Expansion hängt davon ab, dass der Emittent der Weltleitwährung, die USA, bereit ist, ein chronisches Defizit, bzw. eine hohe Staatsverschuldung zu fahren. Diese Situation ist in sich instabil, erklärt aber nur zu gut, warum die Finanzmärkte sich so wenig um die US-Staatsverschuldung scheren.
Jede in sich instabile Situation muss irgendwann ihr Ende finden. Der Dollar-Index hat seit Ende des Bretton Woods Systems drei Abwärts- und zwei Aufwärtszyklen durchlaufen, die im Schnitt rund sieben Jahre anhielten. Der dritte Abwärts-Zyklus startete 2001 nach Platzen der Technologieblase und mit der Finanzialisierung der Rohstoffmärkte, er endete auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Das damals markierte Tief wurde, bedingt durch bedeutende Asset-Verlagerungen aus dem Dollar heraus, 2011 erneut getestet und hielt.
Wie sich aus dem Chart ablesen lässt, fallen weltwirtschaftlich problematische (kontraktive) Phasen mit Dollar-Stärke zusammen, was angesichts des Status des Dollar als Leitwährung auch plausibel ist. Eine Ausnahme von dieser „Regel“ gab es zwischen 1995 und 2001, als sich die Technologieblase entwickelte und der Immobilienboom in den USA startete.
Kommt jetzt eine neue Aufwärts-Phase im Dollar-Index? George Magnus, UBS, hält das für wahrscheinlich, auch Tom Fitzpatrick von der Citibank sieht Ähnlichkeiten im gegenwärtigen Chart des Dollar-Index zu dem von 1995+. Ein wichtiger Punkt bei der zu erwartenden Dollar-Stärke ist die durch die massive QE-Politik der Bank of Japan bedingte Yen-Schwäche.
Wenn es nur Zypern und die Eurokrise wäre… Die Politik geht die wirklich brennenden strukturellen Probleme unserer Tage beiderseits des Atlantiks nicht an – ob aus Unwilligkeit, Unfähigkeit, Sturheit oder Dummheit, ist dabei zweitrangig. Der folgende Chart zeigt, dass „Deleveraging“ bisher nicht stattgefunden hat – im Gegenteil. Dabei stellt er nur die im offiziellen Haushalt dargestellten Schulden dar. Im Falle Deutschlands sind die gesamten Staatsschulden unter Einschluss von Pensionsverpflichtungen usw. mehr als vier mal so hoch wie der „offizielle“ Wert.
Ein weiterer Beleg für die Strukturprobleme ist die Gegenüberstellung der BIP-Entwicklung in den Emerging Markets zu der in den industrialisierten Ländern.
Die Zentralbanken haben begonnen, das wirtschaftspolitische Heft selbst in die Hand zu nehmen und handeln an Stelle der Politik, der das bis zu einem gewissen Ausmaß recht ist. Das jüngste Beispiel hierfür lieferte die Bank of Japan.
Die letzten, die sich darüber Illusionen machen, dass sich die bisherige Geldflutpolitik als zunehmend ineffizient erweist, dürften die Zentralbanker selbst sein. Den Hinweis von EZB-Draghi, es werde über neue unkonventielle Maßnahmen nachgedacht, sollte man perspektivisch ernst nehmen.
Niels C. Jensen spekuliert, dass die Zentralbanken eine koordinierte Aktion vorbereiten, um das globale wirtschaftliche und monetäre System neu zu organisieren. Möglicherweise müssten hierzu die politischen Führer an die Wand gedrückt und so zu einheitlichem Handeln gezwungen werden, was nur in einer scharfen Krise möglich ist, schreibt er.
Diese neue „Ordnung“ würde zunächst wohl auf eine neue Reserverwährung hinauslaufen, die den Dollar ablöst. Damit wären die USA aus ihrem Dilemma (s.o.) befreit, was der Wirtschaft dort wohl sehr helfen wird. Der Trend, Produktion ins Land zurückzuholen, hat bereits begonnen. Mag sein, dass im selben Atemzug der Euro zu existieren aufhört – angesichts der besonders großen strukturellen Probleme und ihrer unterschiedlichen regionalen Ausprägung in Europa ist diese Währungsunion sowieso ein Auslauf-Modell.
Bis es so weit ist, dürfte die Hauptmasse der kritischen Staatsschulden in den Bilanzen der Notenbanken gelandet sein, meint Jensen. Damit ist die Kontrolle v.a. der langfristigen Zinsen auch kein Problem. Dann dürfte eine radikale Restrukturierung der Staatsschulden folgen, insbesondere des nicht in den offiziellen Bilanzen stehenden Teils (Pensionsrückstellungen, Sozialsystems usw.).
Vielleicht werden im selben Atemzug auch die größten Banken auf der Welt aufgebrochen, meint Jensen und warnt, das sei zwar alles Spekulation und würde womöglich nie eintreten. Aber wetten sollte man darauf nicht. Ob zwischenzeitlich eine neue Bullphase im Dollar-Index die nächste Finanz-Krise vorbereitet (Vorbild 1995 bis 2000/2001?) oder ob die aus einer ganz anderen (politischen oder militärischen) Ecke kommt, ist schwer zu sagen.
Genauso steht es mit dem Timing. Zunächst dürfte die laxe Geldpolitik ungebremst weiter gehen und die Risikoneigung weiterhin hoch halten, was sich u.a. an der sehr verhaltenen Reaktion auf die Zypern-Krise zeigte. Nullzinsen, Geldflut und zunehmende Risikoneigung führen zu Asset-Blasen und deren Platzen führt in die nächste Finanz-Krise – ein womöglich für die Zentralbanken im obigen Sinne nicht ganz unwillkommenes Szenario.
Ich kann der Spekulation von Jensen einiges abgewinnen. Die Zentralbanken werden den von ihnen eingeschlagenen Weg weitergehen und dafür sorgen, dass die Politik umsetzt, was sie für richtig halten. Ob die Zentralbanken dabei aber zu einer einheitlichen Strategie finden, ist eine spannende Frage. Dass die Fed so oder so dominieren wird, gilt für mich als ausgemacht. Womöglich steuert tatsächlich alles auf den (Krisenhöhe-)Punkt zu, an dem es nur noch besser werden kann. Mag sein, dass schizophrenerweise die Aktienkurse kurz davor ihr Hoch hatten.